Zahnmedizin
Gefahrgut im Mund
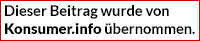

Quecksilber ist im Prinzip ein Gefahrengut- und doch haben es viele Menschen im Mund wo es eigentlich nichts zu suchen hat: Die Amalgamfüllungen. Sie besteht zu etwa 50 Prozent aus dem Schwermetall.
Was ist Amalgam
Amalgam ist eine Legierungen (Mischungen) von Quecksilber mit verschiedenen Metallen wie Silber, Zinn, Kupfer und Zink. Der Zahnarzt füllt das Amalgam in knetbarer Konsistenz in den Zahndefekt ein, wo es dann aushärtet. Was die Zahnlöcher stopft, mutiert zu Gift, sobald irgendwann die Füllung entfernt wird. Deshalb müssen alle Zahnarztpraxen in der Schweiz mit einem entsprechenden Abscheider ausgerüstet sein.
Amalgamreste sind als Sondermüll zu entsorgen
EU und UN haben das Ziel, die Verwendung von Quecksilber deutlich zu reduzieren, denn es ist nicht abbaubar. Norwegen und Schweden haben bereits 2008 bzw. 2009 entschieden, dass quecksilberhaltige Produkte nicht mehr erlaubt sind. Damit sind auch Amalgamfüllungen verboten. In anderen europäischen Ländern wird ein Verbot seit vielen Jahren diskutiert.
Die Schweiz sieht das anders. 2009 lehnte der Bundesrat eine Eingabe ab, die Quecksilber in Zahnfüllungen verbieten wollte. Ein Verbot lasse sich „aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht rechtfertigen“.
Schätzungsweise 10.000 Kilo Amalgam tragen Schweizerinnen und Schweizer gegenwärtig noch im Mund. Diese Menge verringere sich jährlich um 150 bis 350 Kilo. Wie häufig Amalgam heute noch verwendet wird, weiss allerdings niemand.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äussert sich hingegen wie folgt zum Almagam: „Laut aktuellem Kenntnisstand sind die derzeit vorhandenen Restaurationsmaterialien, einschliesslich Dentalamalgam, als sicher und zuverlässig zu betrachten. Allerdings kommt es gelegentlich zu biologischen Gegenanzeigen. Diese sind jedoch individuell bedingt und demgemäss individuell zu behandeln.
Und gar ein wissenschaftlicher Beratungsausschuss der EU kam 2014 zum Schluss, die Gesundheits- und Umweltgefährdung durch Dentalamalgam sei „verhältnismässig gering“.
Bedenkliche Belastung mit Quecksilber
Doch dass das Schwermetall Quecksilber sich in Organen anreichert, belegen mehrere Autopsiestudien: So fand etwa die Italian Association for Metals and Biocompatibility Research bei Toten mit mehr als zwölf Amalgamplomben einen zehnfach erhöhten Quecksilbergehalt in Organen und Gehirn im Vergleich zu denen, die weniger als drei Plomben hatten.
„Die gesundheitlichen Schäden, die durch eine chronische Quecksilberbelastung entstehen, können gravierend sein“, sagt Peter Jennrich von der Ärztegesellschaft für klinische Metalltoxikologie. Häufig kommt es zu Symptomen wie innere Unruhe und Abgeschlagenheit sowie Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden.
„Darüber hinaus kann eine Vergiftung mit dem Schwermetall auch Co-Faktor für beinahe alle chronischen Erkrankungen sein“, ergänzt er. Zum Beispiel Diabetes, Multiple Sklerose und Autoimmunstörungen wie Rheuma.
Was der Vergiftungsgefahr entgegenwirkt
Die Schwere der Vergiftung und damit ihrer Folgen hängt nicht nur von der Menge Amalgam im Körper ab. Als Faktoren kommen die Belastung mit anderen Toxinen – etwa durch bleihaltiges Trinkwasser – und der Gesundheitszustand der Betroffenen hinzu.
„Ist jemand in guter körperlicher Verfassung, sind Entgiftungsfähigkeit und Belastungstoleranz in der Regel höher“, erklärt Jennrich. So bleibt mancher trotz hoher Schwermetallbelastung beschwerdefrei, während andere sehr schnell reagieren. Dies und der Umstand, dass die Symptome einer chronischen Vergiftung sehr unspezifisch sind, macht eine eindeutige Diagnose schwer. Und führt indirekt dazu, dass die Negativauswirkungen der „Quecksilber-Dauerexposition“ nach wie vor umstritten sind.
Quecksilber-Belastung nachweisen
Ob eine Vergiftung vorliegt und wie stark sie ist, kann meist nicht durch eine Standarduntersuchung herausgefunden werden. „Weder eine reguläre Blutanalyse noch eine Urinprobe zeigen alles“, so Jennrich. Da die Schadstoffe sich in Gewebe und Organen anreichern, bringt nur ein spezieller Provokationstest Klarheit. Dieser erfolgt, indem ein Chelatbildner verabreicht wird – eine organische Verbindung, die in der Lage ist, versteckte Metallionen zu binden und abzuführen.
Dadurch wird das tatsächliche Ausmaß der Belastung im Urin messbar. Von diesem Ergebnis hängt die Therapie ab. Dazu gehören das Entfernen der Amalgamplomben sowie eine Schwermetallausleitung. Letztere kommt auch bei akuten Vergiftungen – etwa nach Chemieunfällen – zum Einsatz und erfolgt am effektivsten mit Chelatbildnern.
Bei vielen Zahnärzten hat Amalgam einen hohen Stellenwert. Es lässt sich besonders gut verarbeiten und geradezu ideal in das Loch im Zahn einfügen. Andere Zahnärzte dagegen verweigern den Gebrauch von Amalgam und sehen die Risiken für die Gesundheit der Patienten kritisch. Ob Amalgam tatsächlich Schäden verursacht oder nicht, ist zum jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen.
